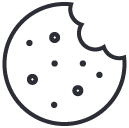Hintergrundwissen
Online-Begleitung für Freiwillige an Europas (Außen-)Grenzen
2. Rassismus, Eurozentrismus, White Saviourism, Voluntourismus
Als Freiwillige*r in der Unterstützungsarbeit mit Menschen auf der Flucht ist es unserer Meinung nach sehr wichtig, sich mit bestimmten Aspekten von Rassismus und den Konzepten des Eurozentrismus, Voluntourismus und White Saviourism kritisch auseinanderzusetzen. Lass dich von den komplizierten Begriffen nicht abschrecken, falls du sie nicht kennst. Klicke auf die jeweiligen Konzepte für eine kurze Definition und eine Erklärung, warum sie in diesem Kontext eine wichtige Rolle spielen. Teile der Einheit, insbesondere die Absätze “Was bedeutet das für dich und deine Arbeit mit Menschen auf der Flucht?” sind vor allem für privilegierte Menschen aus dem Globalen Norden ohne Rassismuserfahrung, die nicht von Grenzpolitiken betroffen sind, konzipiert.
Rassismus
[diese Einheit erklärt Rassismus insbesondere für Menschen, die selber nicht negativ von Rassismus betroffen sind]
In Kürze: Was bedeutet Rassismus?
- Rassismus ist ein globales soziales Phänomen, das nicht losgelöst von seiner historischen Verbindung mit dem Kolonialismus, Versklavung, ökonomischer Ausbeutung und der Entstehung des Kapitalismus betrachtet werden kann, die bis heute unsere Gesellschaft maßgeblich prägen.
- Es fällt insbesondere Menschen, die nicht negativ von Rassismus betroffen sind, nicht immer einfach, Rassismus in all seinen Facetten und Erscheinungsformen sofort zu erkennen:
- Rassismus kann sich sehr deutlich und offensichtlich äußern, beispielsweise bei Menschen, die sich mit menschenfeindlichen Parolen klar zu einer rassistischen Gesinnung bekennen. Hier werden Menschen aufgrund ihres Geburtsortes, ihres äußeren Erscheinungsbilds, ihrer Religion oder Sprache als weniger menschlich betrachtet und abgewertet. Dazu gehört auch, dass Schutzsuchenden der Zugang zu Sicherheit verwehrt wird.
- Rassismus kann sich aber auch in alltäglichen und sprachlichen Formen auf individueller Ebene, sowie auf institutioneller und rechtlicher Ebene äußern. Diese Formen von Rassismus sind häufig subtiler und vielschichtiger, weshalb es oft viel schwerer fällt, sie direkt als Rassismus zu erkennen und zu benennen. Diese Formen von Rassismus tragen wir alle mit uns. Aufgrund der verschiedenen Formen des Rassismus wird auch im Plural von Rassismen gesprochen. Deswegen ist es immer notwendig, sich verantwortungsvoll mit Rassismus und Rassismen auseinanderzusetzen, auch wenn man sich selbst als antirassistisch versteht.
Konsequenzen von Rassismus
- Das ist Rassismus: Menschengruppen werden von Weißen anhand von Geburtsort, Nationalität, Glaube oder Aussehen in “Wir” und “die Anderen” eingeteilt, und das "Wir" wird positiv und das "Andere" als negativ wahrgenommen..
Schau dir hierzu gern dieses kurze Video an. - Das ist Rassismus: Manche Menschen erhalten einfach ein Visum oder brauchen es nicht einmal, um durch die Welt zu reisen. Gleichzeitig müssen andere Menschen die Gefahr einer gefährlichen Flucht über das Mittelmeer oder andere Routen eingehen, um in Sicherheit leben zu können.
Schau dir hierzu gern den Henley-Passport-Index an, der zeigt, wie viele Länder man visumsfrei mit welchem Reisepass bereisen kann und damit aufzeigt, wie Staatsbürgerschaft die Reise(un)freiheit beeinflusst. - Das ist Rassismus: Menschen wird ein bestimmter Wert zugesprochen, je nachdem, für wie produktionsfähig, das heißt für die Wirtschaft profitabel, sie gehalten werden. Migrations- und Asylrecht baut fast ausschließlich auf dieser Grundlage auf. Das bedeutet, dass Menschen Bewegungsfreiheit verwehrt wird, wenn sie als nicht wirtschaftlich produktiv gelten.
Unser Buchtipp hierzu: Achille Mbembe - Kritik der schwarzen Vernunft - Diese tiefer liegende Form des Rassismus nennt man auch strukturellen Rassismus.
Das bedeutet:
- Wir alle haben rassistische Verhaltens- und Denkmuster in uns, da wir in einer rassistisch geprägten Welt aufgewachsen sind und sozialisiert wurden.
- Wir alle leben in Strukturen, die bestimmte Menschen privilegieren und andere diskriminieren.
- Diese Strukturen haben sich im Zuge von Kolonialisierungen und der systematischen Unterdrückung und Ausbeutung großer Bevölkerungsgruppen historisch entwickelt und setzen sich bis heute fort.
- Gerade weil es sich dabei um etwas Strukturelles handelt, ist Rassismus weniger an einzelne Individuen gebunden, sondern setzt sich in Vorstellungen, in Weltanschauungen, in medialen Darstellungen, in der Arbeit von Institutionen sowie im internationalen Recht um. Kleine, vielleicht sogar harmlos erscheinende Fragen oder Kommentare zum Aussehen oder der Herkunft von Menschen können aufgrund der strukturellen Verwurzelung rassistisch sein.
Man muss kein*e Rassist*in sein, um rassistisch zu denken, um Rassismus zu reproduzieren oder um von Rassismus zu profitieren. Weiße Menschen des Globalen Nordens profitieren von diesen Privilegien, ob sie dies aktiv wollen oder nicht. Gehörst du zu dieser privilegierten Gruppe, kannst du zunächst wenig daran ändern. Du solltest dir deiner Position jedoch stets bewusst sein und kritisch und reflektiert damit umgehen. Für eine solche kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Position und deren Bedeutung in Bezug auf die Arbeit mit Geflüchteten sollen dir die folgenden Themen und Erklärungen helfen.
Was bedeutet das für dich und deine Arbeit mit Menschen auf der Flucht?
- Versuche nicht, deine eigenen Rassismen zu verleugnen: Da die Rassismen unserer Gesellschaft derart strukturell und tiefgreifend sind, kann sich niemand vor ihnen verschließen, sie prägen und beeinflussen unsere Sozialisation, unser Denken und unser Handeln. Umso wichtiger ist es also, die eigenen von Rassismus geprägten Denkweisen, Vorstellungen und Bilder zu erkennen, sich dieser bewusst zu werden, um ihnen dann aktiv entgegenzuwirken.
- Lerne die Perspektive von Betroffenen kennen: Weiße Personen können Diskriminierungserfahrungen von People of Colour (häufig) nicht sehen, da sie selbst nicht davon betroffen sind. Das bedeutet aber nicht, dass du Betroffene nach ihren Diskriminierungserfahrungen ausquetschen solltest. Sie sind nicht für deinen internalisierten Rassismus verantwortlich und sollten daher auch nicht als deine persönlichen Aufklärer*innen ausgenutzt werden. Es gibt viele Artikel, Videos, Podcasts und Bücher, in denen Betroffene ihre Erfahrungen teilen. Eine kleine Auswahl haben wir weiter unten für dich bereitgestellt.
- Werde dir deiner Verantwortung bewusst: Weiße Personen haben das Privileg, sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen, da sie nicht davon betroffen sind, das heißt aber, dass weiße eine (historisch gewachsene) Verantwortung besitzen, sich aktiv und selbstkritisch mit den eigenen Rassismen auseinanderzusetzen und gegen sie anzukämpfen. Das bedeutet auch für dich, dich gegen rassistische Institutionen und Gesetze einzusetzen.
- Setze sich mit deinen eigenen Stereotypen, Vorurteilen und deiner eigenen eurozentrischen Perspektive auseinander: Versuche, deine eigenen Vorstellungen von Menschen und Menschengruppen zu überdenken und Vorurteile zu enttarnen und abzulegen. Hinterfrage kritisch, welche Vorstellung du davon hast, wie sich Menschen und Gesellschaften “zu entwickeln haben” und inwiefern diese Vorstellung von deiner eigenen Herkunft geprägt ist.
Weitere Lese-/Videotipps:
- Erklärungsvideo zu Alltagsrassismus: How micro aggressions are like mosquito bites
- Ein Ted Talk von Chimananda Ngozi Adichie The danger of a single story
- Buch von Alice Hasters (2019): “Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten”
- Buch von Tupoka Ogette (2018): “Exit Racism”
- Buch von Mohamed Amjahid (2021): “Der weiße Fleck - Eine Anleitung zum antirassistischen Denken”
Eurozentrismus
[diese Einheit erklärt Eurozentrismus für Menschen, die eurozentristisch aufgewachsen sind]
Was bedeutet Eurozentrismus?
- Als Eurozentrismus wird eine Einstellung bezeichnet, welche europäische Lebensweisen, Normen und Werte bzw. die, die als “westlich” verstanden werden, unhinterfragt in den Mittelpunkt des Denkens und Handelns stellt und sie als Standard begreift.
- Dabei geht es nicht nur um das Phänomen, dass Menschen sich zunächst an dem orientieren, was sie gewohnt sind und aufgrund ihres eigenen Lebens und kultureller Sozialisation kennen - denn das tun wir alle. Vielmehr geht es bei Eurozentrismus um eine aktive Abgrenzung zu “den Anderen”, die auf einer Abwertung dieser und einer damit einhergehenden Erhöhung des “Eigenen” beruht. Beim Eurozentrismus (der als Teil des Ethnozentrismus gilt) geht es also nicht um den Versuch, andere Kulturen oder Lebensweisen besser zu verstehen, sondern bestehende Hierarchien und Ungleichheiten aufrechtzuerhalten, bzw. zu rechtfertigen.
- Dass diese europäischen bzw. “westlichen” Normen, Werte und Lebensweisen weltweit Gültigkeit beanspruchen, hat ihren Ursprung zu großen Teilen in der Kolonialgeschichte und deren bis heute andauernden Folgen.
Konsequenzen von Eurozentrismus
- Die Kolonialgeschichte brachte ein starkes Ungleichgewicht von globalen Reichtums- und somit auch Machtverhältnissen zugunsten des Globalen Nordens hervor, welche bis heute besteht und durch anhaltende Ausbeutungsmechanismen und globalen Kapitalismus verstärkt wird.
- Diese ungleiche globale Machtverteilung hat auch zur Folge, dass die Definitionsmacht darüber, was der kulturelle/soziale oder materielle Standard, die Normalität und das Erstrebenswerte ist, stärker vom Globalen Norden eingenommen werden kann und wird.
- Ausgehend von der Annahme, dass die kulturellen und politischen Systeme Europas das ideale Modell universeller Vernunft und menschlicher Entwicklung darstellen, wird Europa oder “der Westen” mit dem Konzept liberaler Demokratien aufbauend auf christlichen Werten als globaler Maßstab gesellschaftlicher und politischer Praxis betrachtet.
- Diese Überlegenheitsvermutung geht häufig mit der Annahme einher, “die Anderen” wären in ihren gesellschaftlichen oder kulturellen Entwicklungen in einem rückständigen Stadium.
- Die Denkweise, dass nicht-europäische oder nicht-westliche Gesellschaften in einem Stadium verharren, welches “der Westen” bereits überwunden habe, führt auch zu der überheblichen Haltung, “der Westen” müsse ihnen bei einer fortschrittlichen Entwicklung helfen.
Das bedeutet:
- Es handelt sich bei diesen Einteilungen in “fortschrittlich” und “rückständig” nicht um gegebene Wahrheiten, sondern um europäische Konstruktionen und Fantasien, die dazu beitragen, den Globalen Norden und Europäer*innen bzw. weiße Menschen in einer Vormachtstellung zu halten.
- Indem aus einer eurozentristischen Perspektive beispielsweise die ungleichen ökonomischen und politischen Verhältnisse zwischen Globalem Norden und Süden damit erklärt werden, dass “die Anderen” eben noch nicht so modern, fortschrittlich, entwickelt seien, wird es sich leicht gemacht: Menschen des Globalen Nordens machen Menschen des Globalen Südens für die Verhältnisse verantwortlich und verleugnen die eigene Verantwortung.
- Mit solchen Erzählungen wird erreicht, dass die gewalttätige koloniale Vergangenheit und die daraus entstandenen gegenwärtigen politischen und ökonomi¬schen Verhältnisse ignoriert und verschleiert werden.
- Gleichzeitig können Menschen aus dem Globalen Norden die Vorteile, die sie tagtäglich daraus ziehen, als eigene Leistung wahrnehmen und so tun, als ob sie ihnen quasi selbstverständlich zustehen – obwohl sie nichts dafür getan haben. So wird Ungleichheit zu einer natürlichen Gegebenheit gemacht, wodurch ihr Weiterbestehen nicht in Frage gestellt wird. Damit wird deutlich, dass das Nichtbenennen von Geschichte und eigener Bevortei¬lung in der Gesellschaft eine aktive, interessengeleitete Handlung ist und nicht einfach nur unschuldige Unwissenheit oder Vergessen.
Lesetipps zum Thema Eurozentrismus:
- Utopia (2023): Eurozentrismus: Bedeutung und Auswirkungen (DE)
- Bundeszentrale für politische Bildung (2015): Eurozentrismus in der Entwicklungszusammenarbeit (DE)
- Auch dieses Dokument von glokal e.V. können wir sehr empfehlen: Mit Kolonialen Grüßen (DE)
Was bedeutet das für dich und deine Arbeit mit Menschen auf der Flucht?
- Reflektiere deine Sicht auf und deine Bewertung der Handlungen anderer Menschen: Während deiner Tätigkeit wirst du dich immer wieder in Momenten wiederfinden, in denen Menschen andere Entscheidungen treffen, anders handeln oder reagieren, als du es getan hättest. Vielleicht fällt es dir schwer, diese Entscheidungen nachzuvollziehen oder zu verstehen. Das Wichtige ist in diesen Momenten, dass du andere Herangehensweisen, Entscheidungen oder Handlungen respektierst und deine Meinung und Perspektive nicht automatisch über ihre stellst.
- Reflektiere deine eigene eurozentristische Haltung: Versuche, zu erkennen, wo und in welcher Form du eurozentristischen Denkweisen folgst. Folgende Fragen können dir dabei helfen:
- Wie könnten die schutzsuchenden Menschen, mit denen ich arbeite, meine Teammitglieder, aber auch die lokale Bevölkerung, bestimmte Situationen wahrnehmen und beurteilen in Anbetracht ihrer Sozialisation und kulturellen Herkunft?
- Was setze ich vielleicht voraus? Welche Normen muss ich hinterfragen?
- Gibt es im eigenen Weltbild ethische Prinzipien, die dem Akzeptieren von Wertvorstellungen und Praktiken anderer Kulturen Grenzen setzen?
- Äußere dich nicht belehrend: Die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest oder zusammenarbeiten wirst, bringen verschiedene Lebensweisen, Erfahrungen und meist auch traumatische Fluchtgeschichten mit. Womöglich wirst du einige ihrer Entscheidungen nicht verstehen können, da du vielleicht ihre Erfahrungen, Gewohnheiten oder Vorlieben nicht nachvollziehen kannst. Achte darauf, dass du deine Ansichten und Entscheidungen nicht über ihre stellst und niemals belehrend auf sie einwirkst.
White Saviourism
Was bedeutet White Saviourism?
- White Saviourism (Weiße-Retter*innen-Komplex) beschreibt die Vorstellung oder Überzeugung, dass es das Einschreiten weißer Menschen aus dem Globalen Norden bedarf, um andere (nicht-weiße) Menschen(gruppen) aus ihrer Unterdrückung oder auch einfach nur aus einer scheinbar mangelhaften Lebenssituation zu “retten”.
- White Saviourism bezeichnet somit das Phänomen, dass Menschen glauben (bewusst oder unterbewusst), ihre Herkunft, ihre Erziehung und (Aus-)Bildung in einem Land des Globalen Nordens, verleihe ihnen das Recht, das Wissen und die Legitimation, um andere Menschen „aufzuklären“. Dabei spielt Eurozentrismus eine große Rolle, denn die Maßstäbe von dem, was oder wer wie zu retten gilt, werden an europäischen Standards orientiert.
- Lies mehr dazu in unserem Blogeintrag über den White-Saviour-Komplex
Konsequenzen von White Saviourism
Besonders deutlich wird dieses Phänomen in den zahlreichen, zwar hochmotivierten, aber unausgebildeten Abiturient*innen, die nach dem Schulabschluss in die Welt bzw. den Globalen Süden ziehen, um in sogenannten Hilfsprojekten “etwas Gutes zu tun” oder um “zu helfen”.
Das bedeutet:
- Die Tatsache, dass junge Menschen, die meist nicht die notwendigen Qualifikationen besitzen, dennoch in Projekten der sogenannten „Entwicklungszusammenarbeit“ eingesetzt werden, macht deutlich, welche Überheblichkeit des Globalen Nordens mit diesem Format einhergeht.
- So werden nicht nur historisch alt eingesessene Hierarchisierungen und von Rassismus geprägte Bilder der passiven und hilfsbedürftigen „Anderen“ reproduziert, sondern auch komplexe politische und soziale Themen stark verkürzt dargestellt.
- Das Phänomen des White Saviourism ist nicht nur in der Arbeit von Organisationen des Globalen Nordens, die im Globalen Süden tätig sind, zu finden, sondern an sehr vielen (alltäglichen) Stellen, wie z.B. in der Selbstdarstellung von Menschen in den Sozialen Medien oder in zahlreichen Hollywood-Filmen, in denen es vermeintlich weißer Held*innen bedarf, um andere Menschen aus ihrer diskriminierten Position zu befreien.
Was bedeutet das für dich und deine Arbeit mit Menschen auf der Flucht?
- Sei dir deiner Position und Rolle bewusst: Als Freiwillige mit Menschen auf der Flucht findest du dich in einer Situation wieder, die sich aus nur schwer erträglichen Machtdynamiken und Abhängigkeitsverhältnissen zusammensetzt. Sei dir deiner eigenen Position bewusst, nutze sie nicht aus und versuche, einen guten Umgang mit dieser Rolle zu schaffen. (Schau dir hierzu gern unsere Einheit 6 an!)
- Versuche deine eigene Motivation ehrlich zu ergründen: Versuche zu verstehen, weshalb du diese Arbeit machen willst. Was motiviert dich? Vielleicht hast du den Wunsch danach, “etwas Gutes zu tun”, vielleicht sogar das Bedürfnis nach Dankbarkeit und Anerkennung. Sei dir dieser Aspekte bewusst und versuche, sie kritisch zu reflektieren. Sprich mit deinen Teammitgliedern und anderen Freiwilligen darüber. Es ist in Ordnung, solche Gedanken und Wünsche zu haben, sie sollten jedoch nicht den Hauptteil deiner Motivation ausmachen. Du solltest allen Menschen immer auf Augenhöhe begegnen.
- Achte auf die Außenwirkung deiner Arbeit: Sei dir stets darüber im Klaren, welche Wirkung deine Berichte oder Posts auf Sozialen Medien haben können. (Schau zu diesem Thema in unsere Einheit 7 rein!)
Weitere Lese- / Video- / Hörtipps zum Thema:
- Podcast: No White Saviors (EN)
- Podcastfolge von Feuer und Brot (2020): White Saviorism - Warum gut gemeint oft nicht hilfreich ist (DE)
- Satirisches Video: Africa For Norway (EN)
- Satirisches Video: White Savior: The Movie Trailer (EN)
- Artikel von Nova Reid (2021): No more white saviours, thanks: how to be a true anti-racist ally (EN)
Voluntourismus
Was bedeutet Voluntourismus?
- Ein besonderes Phänomen von internationaler Freiwilligenarbeit ist der sogenannte Voluntourismus, also eine Verbindung von “Volunteering” (engl.: Freiwilligenarbeit) und “Tourismus”, bei dem letzteres im Fokus steht. Bei den Anbietern solcher Formen von Freiwilligenarbeit handelt es sich meist um Agenturen, die Freiwilligenarbeit vor allem als Teil einer spannenden Reise und als Abenteuer anpreisen. Die Qualifikation und Eignung der Freiwilligen für die Mitarbeit im Projekt steht hier weniger im Fokus, als ihre finanziellen Möglichkeiten, die Reise und den Anbieter zu finanzieren.
- Das Geld, welches Freiwillige für solche Aufenthalte bezahlen, fließt meist nur bedingt in das Projekt vor Ort.
- Auch sehr kurze Tätigkeiten von Freiwilligen, die in eine größere Reise eingebettet sind, können als Voluntourismus verstanden werden.
- Im Kontext mit Menschen auf der Flucht äußert sich Voluntourismus vor allem im "Katastrophen-" bzw. "Krisentourismus". Freiwillige reisen in humanitäre Projekte und Camps, hauptsächlich um sich einen Eindruck von der Situation vor Ort zu verschaffen, Fotos zu machen, Menschen über ihre Flucht auszufragen und im Anschluss von ihren Erfahrungen berichten zu können. All dies hat touristische Elemente, die nichts mit Freiwilligen- und Unterstützungsarbeit zu tun haben sollten.
Konsequenzen von Voluntourismus
- Die Vorteile dieser Freiwilligenarbeit kommen dabei einzig und allein den Freiwilligen selbst zugute: Sie erleben ein internationales und interkulturelles “Abenteuer”, machen neue Bekannt- und Freundschaften, können die Erfahrungen meist in ihren Lebensläufen nutzen und schließen ihren Aufenthalt ungeachtet der realen Konsequenzen mit dem Gefühl ab, “etwas Gutes” getan zu.
- Für die Menschen, die unterstützt werden sollen, ist diese Form der Freiwilligenarbeit meist eher schädlich als nützlich, da nicht die Unterstützung im Sinne des Projekts respektiert und verfolgt wird, sondern die Erfahrung und das Vergnügen der Freiwilligen priorisiert werden.
Das bedeutet:
- Durch derartige Formen von Freiwilligenarbeit werden erneut historisch verankerte Hierarchisierungen und von Rassismus geprägte Bilder der passiven und hilfsbedürftigen „Anderen“ (hier: Menschen auf der Flucht) reproduziert, die sich über jegliche Aufmerksamkeit von Freiwilligen freuen sollen / müssen.
- Gleichzeitig mangelt es häufig an Fachwissen und Qualifikation der Freiwilligen, was nicht zwingend den Freiwilligen anzulasten ist, aber trotzdem problematisiert werden muss:
- Aufgrund der andauernden Situation an Europas (Außen-)Grenzen und dem fehlenden politischen Willen, etwas an dieser Situation zu ändern oder auch nur professionelles und ausgebildetes Personal für diese politische Krise bereitzustellen, bedarf es weiterhin der Arbeit vieler Freiwilliger in diesem Bereich.
- Dies hat auch zur Folge, dass Menschen, die eigentlich nicht über die für diesen Bereich notwendige Qualifizierung verfügen, in den Projekten arbeiten und sie koordinieren.
- Trotz bzw. gerade wegen dieser Umstände ist es umso wichtiger, dass die Projekte selbst über eine gewisse Stabilität verfügen und in der aktuellen Situation auch langfristig funktionsfähig sind. Projekte, die nach kurzer Zeit im Sande verlaufen, erzeugen eine Erwartungshaltung oder schaffen Hoffnungen, die dann zerstört oder enttäuscht werden und richten so häufig einen höheren Schaden an, als dass sie langfristig zur Lösung beitragen.
Was bedeutet das für dich und deine Arbeit mit Menschen auf der Flucht?
- Schau genau hin bei der Auswahl deiner Organisation: Erfüllt die Organisation, für die du arbeiten möchtest ein gewisses Maß an Nachhaltigkeit und kritischer Selbstreflexion? Projekte, die zwar gut gemeint sind, sich aber nicht lange genug halten können oder Versprechungen machen, die sie nicht einhalten, können viel Schaden anrichten. Do no harm!
- Hinterfrage vor diesem Hintergrund selbstkritisch deine Motivation: Versuche in dich hineinzuhorchen: Findest du Aspekte des Voyeurismus in deiner Motivation? Mit anderen Worten: Spielt der Reiz, den solche Krisen und politische Katastrophen manchmal auf Menschen ausüben, eine entscheidende Rolle in deiner Motivation? Gehe in dich und versuche, deine Gründe auf dieser Grundlage selbstkritisch zu hinterfragen. Die Unterstützungsarbeit mit Menschen auf der Flucht sollte niemals Katastrophentourismus sein, sondern eine Handlung aus Solidarität.
Fragen? Kritik? Anmerkungen? Ergänzungen?
Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen und hilfreiche Hinweise von Euch! Schreibt uns einfach eine Email: kontakt@brueckenwind.orgDu möchtest unsere Inhalte teilen?

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz