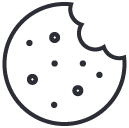Hintergrundwissen
Online-Begleitung für Freiwillige an Europas (Außen-)Grenzen
1. Freiwilligenarbeit im Kontext europäischer Grenzpolitiken
In welchem Kontext befindest du dich als Freiwillige*r, die mit People on the Move arbeitet? Welche verschiedenen Organisationsformen gibt es und wie sollte eine solidarische Unterstützungsarbeit (nicht) aussehen? In dieser Einheit wollen wir uns anschauen, wie Hilfsorganisationen, Initiativen und solidarische Gruppen, die Geflüchtete unterstützen, aufgebaut sind und warum es relevant ist, sich mit diesen Strukturen zu beschäftigen, um solidarisch Freiwilligenarbeit leisten zu können.
Der Kontext
Die Unterstützung für People on the Move und Geflüchtete ist inzwischen zu einem richtigen “Sektor” geworden. Es gibt über professionelle Hilfsangebote hin zu solidarischen selbstorganisierten Gruppen einige Akteur*innen, die in diesem Kontext tätig sind. Daher ist es sinnvoll - gerade wenn man neu in dem Feld ist - sich mit der Organisationslandschaft zu beschäftigen, um sich zu überlegen, wo man sich anschließen möchte.
Im Zuge des erhöhten Unterstützungsbedarfs, der insbesondere seit dem Sommer 2015 durch das vermehrte Ankommen von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen entstanden ist, haben sich innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl von sogenannte “Ad Hoc Grassroots” Organisationen gebildet, also kleine Organisationen, die sich spontan aus der Zivilgesellschaft heraus gebildet haben. Seitdem leisten sie an verschiedenen Stellen und Lagern an (Außen-)Grenzen der EU Unterstützungsarbeit. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass die jeweiligen Regierungen den erhöhten Bedarf an Leistungen nicht decken konnten oder wollten und es auch noch immer nicht tun.
Zwar gab es bereits vorher Unterstützungsstrukturen, doch seit diesem “langen Sommer der Migration” nehmen die „Graswurzel-Organisationen“ neben weiteren etablierten nicht-staatlichen und staatlichen Organisationen eine bedeutende Rolle im System der Unterstützung von geflüchteten Menschen ein. Viele Organisationen sind aus dem akuten Bedarf heraus und durch zivilgesellschaftliche Intervention auf Privatspendenbasis entstanden, sodass die Organisationsstrukturen hauptsächlich rudimentär und auf kurzfristige Symptombekämpfung wie das Austeilen von Kleidung und Decken bei Kälte, ausgerichtet wurden. Seit einigen Jahren bemühen sich Organisationen angesichts der sich anhaltend schlechten bzw. weiter verschlechternden Situation an den Grenzen der EU und innerhalb der EU jedoch zunehmend, ihren Fokus auf eine eher längerfristige Begleitung der schutzsuchenden Menschen auszurichten. Das heißt, dass sie nun teilweise registriert sind und ihre Strukturen verstetigt haben. Andere Organisationen haben ihre Arbeit allerdings aufgrund staatlicher Repressionen eingestellt.
Die Organisationslandschaft der Unterstützung schutzsuchender Menschen im Kontext der EU-Grenzpolitiken unterliegt einem stetigen Wandel. Es ändert sich, welche Organisationen es gibt, wie die bestehenden aufgebaut sind und wie diese mit den sich verändernden politischen Situationen umgehen. Gleichzeitig existieren sehr unterschiedliche Ansätze der Unterstützungsarbeit.
Ein Unterscheidungsmerkmal von Organisationen, die im Bereich der Unterstützung von geflüchteten Menschen aktiv sind, ist ihre politische Ausrichtung und Positionierung. Es gibt Organisationen, die ihre Aktivitäten klar als Ausdruck einer politischen Überzeugung verstehen und solche, die sich eher als unpolitisch bezeichnen. Für letztere ist Engagement meistens Ausdruck einer religiösen oder humanitären Grundüberzeugung und bezieht sich auf die menschliche Leidensreduktion statt auf politische Ambitionen. Da auch diese sich als ‘unpolitisch’ verstehenden Organisationen jedoch im Kontext von Migration, Flucht und Grenzen in einem sehr politischen Kontext agieren, können sie aus unserer Perspektive als politische Akteur*innen gesehen werden. Denn jedes Eingreifen in die aktuelle migrationspolitische Situation, die von Macht, Unterdrückung und Ungleichheit durchzogen ist, stützt diese entweder oder fordert sie heraus. Ein unpolitisches Selbstverständnis kann dazu führen, dass sich Organisationen unhinterfragt als Unterstützerinnen staatlicher Migrationspolitik positionieren und so indirekt die staatliche Gewalt unterstützen. Die meisten Unterstützungsstrukturen machen aber auf die ein oder andere Weise Diskriminierung, Unterdrückung und ungleiche bzw. ungerechte Behandlung von Migrant*innen und Menschen auf der Flucht sichtbar und versuchen, sie durch verschiedene Strategien anzufechten. Diese Anfechtung passiert manchmal sehr sichtbar mit deutlichen Forderungen an politische Entscheidungsträger*innen oder die Zivilgesellschaft. In anderen Fällen ist sie etwas subtiler durch die praktische Verwirklichung von alternativen Formen des Zusammenlebens, beispielsweise durch gemeinsame Aktionen von People on the Move und Unterstützer*innen, bei denen die Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus keine Rolle spielen. Auf diese Art und Weise werden Diskriminierungen, die auf staatlichen Kategorisierungen basieren, implizit angefochten.
Wenn man versucht, die Unterstützungsstrukturen zu “ordnen”, kann man auch zwischen dem ‘symptombekämpfenden Ansatz’ und dem ‘kritischen Ansatz’ unterscheiden. Die Ansätze hängen von den Zielen, der Organisationsform und der Beziehung zu staatlichen Akteur*innen und Geflüchteten der jeweiligen Organisation ab. Unter den symptombekämpfenden Ansatz’ fallen Unterstützungsangebote wie Beratung, Versorgung und Unterbringung, die damit Lücken staatlicher Verantwortung füllen, und in manchen Fällen auch vom Staat finanziert werden. Sie versuchen, innerhalb der aktuellen Gegebenheiten die Situation für Menschen auf der Flucht zu erleichtern oder verbessern. Unter dem kritischen Ansatz kann man soziale Bewegungen, selbstorganisierte Gruppen oder NGOs einordnen, die sich gegen den Staat stellen und in der Öffentlichkeit für die Rechte von People on the Move einstehen und so politischen Druck ausüben. Sie wollen das Problem eher an der Wurzel angehen und staatliche Asyl- und Migrationspolitik und die damit einhergehenden unterschiedlichen Rechte für Menschen grundsätzlich hinterfragen. Es gibt auch Mischformen von Organisationen, die sowohl Unterstützungsangebote als auch politische Kampagnen machen. Das zeigt, dass freiwilliges Engagement und politischer Aktivismus nicht immer klar voneinander zu trennen sind und sich teilweise in der Kombination sehr gut ergänzen lässt.
Weiterhin kann man zwischen Organisationen unterscheiden, die von Migrant*innen (selbstorganisiert und selbstermächtigend) gegründet und geleitet werden und denjenigen, die (unterstützend) von Menschen ohne Migrations- oder Fluchterfahrung gegründet und geleitet werden. Häufig wird diese Unterscheidung mit der obigen zwischen Gruppen mit politischen oder sozialen Ambitionen und staatsnahen Organisationen gleichgesetzt. Tatsächlich sind in einigen etablierten und staatlich geförderten Hilfsorganisationen Betroffene der europäischen Grenzpolitiken seltener Teil der Organisationsstrukturen als Personen der Mehrheitsgesellschaft. Das ist problematisch, da sie aus ihrer eigenen Erfahrung und Betroffenheit die deutlich größere Expertise über die bestehenden Bedarfe und davon abzuleitenden Unterstützungsmöglichkeiten haben. Dementsprechend bieten auch einige migrantische Selbstorganisationen Unterstützungsangebote an, während auf der anderen Seite natürlich auch Personen ohne eigene Betroffenheit sich aus Solidarität an politischen Kämpfen beteiligen können. Sowohl bei letzteren als auch in Unterstützungsstrukturen können sie ihre Privilegien (wie sicheren Aufenthaltsstatus, Kenntnis über Rechtssystem, soziales Netzwerk etc.) nutzen. In vielen Fällen arbeiten Personen mit und ohne Migrationserfahrung zusammen.
Es wird deutlich, dass diese Einteilungen von politisch/unpolitisch, symptombekämpfend/kritisch und migrantisch/nicht-migrantisch häufig nicht genau so auf Organisationen zutreffen, sondern dass sich die verschiedenen Strukturen in einem Feld zwischen den Kategorien befinden und beispielsweise sowohl praktische Unterstützungsangebote leisten als auch politische Forderungen stellen und Begegnungsräume schaffen, die gegen die staatlich beabsichtigte Isolation von Schutzsuchenden im Asylsystem angeht.
Quellen und Leseempfehlungen:
glokal e.V.: Willkommen ohne Paternalismus. Hilfe und Solidarität in der Unterstützungsarbeit (DE)
Larissa Fleischmann (2020): Contested Solidarity. Practices of Refugee Support between Humanitarian Help and Political Activism (EN)
Sara de Jong und Ilker Ataç (2017): Demand and Deliver. Refugee Support Organisations in Austria (EN)
Der größte Teil der Unterstützungsarbeit geschieht sowohl auf formalisierte als auch weniger formalisierte Art und Weise durch geflüchtete Personen selbst: Entgegen des humanitären Narratives, das geflüchtete Menschen auf das Bild passiver Opfer reduziert, unterstützen sich von den Grenzpolitiken betroffene Menschen gegenseitig in alltäglichen Praktiken (Wissensaustausch, Begleitung zu Terminen, etc.) wie auch durch (politische) Selbstorganisation, sie stellen politische Forderungen und stehen für ihre Rechte ein.
Wir nennen euch ein paar organisierte Gruppen. Allerdings können wir die informelle Unterstützungsarbeit hier nicht verlinken. Häufig gibt es auch Diaspora-Gruppen bestimmter Nationalitäten, die sich gegenseitig unterstützen und politisch organisieren.
- Refugees in Libya
- Refugees in Tunisia
- Moria White Helmets
- Migrationsrat Berlin e.V. (Dachverband von über 70 Migrant*innen-Selbstorganisationen)
- Datenbank Migrant*innen-Organisationen in Hamburg
Wir sprechen die ganze Zeit von europäischen (Außen-)Grenzen. Aber was meinen wir damit und warum schreiben wir Außen immer in Klammern? Eine kurze und knappe Erklärung unseres Verständnisses von Grenzen findest du im Glossar.
Wichtig für uns ist, hervorzuheben, dass Grenzen keine naturgegebenen Tatsachen sind. Auch wenn beispielsweise das Mittelmeer als solches erscheinen mag, wäre es keine tödliche Grenze, wenn es alle Menschen mit Fähren und Flugzeugen einfach überqueren könnten. Dass dies nicht so ist, liegt nicht daran, dass es nicht möglich ist, sondern, dass es politisch nicht gewollt ist.
Das Mittelmeer ist ein Beispiel für eine europäische Außengrenze. Auch andere staatliche Grenzen innerhalb Europas sind für People on the Move relevant. Dass nicht nur staatliche Grenzen eine Rolle spielen, zeigen die beiden Englischen Begriffe border und boundary, für die es im Deutschen nur das Wort Grenze gibt.
Borders werden als Linien zwischen zwei Territorien wahrgenommen und werden mit einem Innen und einem Außen assoziiert. Sie sind daher eng mit dem Territorialstaat verwoben, der Rechtssubjekte (vor allem Bürger*innen) definiert und an Grenzen kontrolliert. Daher sind borders, Staaten und Kontrolle eng miteinander verwoben.
Bei boundaries geht es mehr um den Prozess der Grenzziehung als um die Linie an sich. Sie kann bei allen Unterscheidungen verwendet werden, nicht nur bei geographischen Grenzen. Durch sie werden symbolische Unterschiede (zwischen Klassen, Geschlechtern oder races) geschaffen und Identitäten (nationale, ethnische oder kulturelle Gemeinschaften) hervorgebracht.
Unterstützungsarbeit ist an europäischen Außengrenzen aufgrund der politisch aufrechterhaltenen Situation notwendig. Dennoch möchten wir deutlich machen, dass es einerseits auch andere europäische staatliche Grenzen gibt, die europäische Staatsbürger*innen ohne Probleme passieren können, People on the Move allerdings nicht. Andererseits existieren auch Grenzen innerhalb von Staaten, die sich für Geflüchtete beispielsweise konkret in Sammelunterkünften mitten im Nirgendwo ausdrücken. Da wir all diese Formen von Grenzen zusammenfassen wollen und keinen Unterschied zwischen europäischen Grenzen und Grenzen der EU machen, haben wir die Schreibweise der europäischen (Außen-)Grenzen gewählt.
Quellen:
Bigo, Didier (2005): Frontier Controls in the European Union: Who is in Control? In: Didier Bigo und Elspeth Guild (Hg.): Controlling Frontiers. Free Movement Into and Within Europe. London: Routledge: 49–99.
Fassin, Didier (2011): Policing Borders, Producing Boundaries. The Governmentality of Immigration in Dark Times. In: Annu. Rev. Anthropol. 40 (1): 213–226.
Die Freiwilligenarbeit bewegt sich im europäischen Grenzregime und daher in einem politisch aufgeladenen Feld. Die solidarische Unterstützungsarbeit ist von den verschiedenen Regierungen nicht immer gewollt und erfährt daher teilweise Repressionen und Kriminalisierung. Das heißt aber nicht, dass Unterstützungsarbeit nicht mehr möglich ist. In Griechenland ist eine Konsequenz beispielsweise, dass sich Organisationen nun immer registrieren müssen.
Es gibt zwar mehr Fälle von Kriminalisierung als den in Deutschland medial weitreichenden von Carola Rackete, doch die Organisationen wissen in der Regel, in welchem Rahmen sie sich bewegen. Erkundige dich daher bei deiner Organisation/deinem Projekt, an welche Vorschriften du dich halten solltest.
borderline-europe beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Kriminalisierung (sowohl von Solidarität als auch von Geflüchteten selbst) insbesondere in Griechenland und Italien. Der Verein hat auch eine Übersicht über die verschiedenen möglichen Kriminalisierungformen (EN) erstellt.
Humanitäre Hilfe?
Viele Projekte verorten sich in der humanitären Hilfe. Was humanitäre Hilfe jedoch bedeutet und vor allem, was daran zu kritisieren ist, soll in dieser Einheit thematisiert werden, denn es gibt einige Fallstricke, die zu beachten sind. Da wir dich mit der Kritik jedoch nicht davon abhalten wollen, praktische Unterstützungsarbeit zu leisten, findest du weiter unten Hinweise, wie eine solidarische Freiwilligenarbeit unserer Ansicht nach aussehen sollte.
Das Selbstverständnis von humanitärer Hilfe beinhaltet Maßnahmen zum Schutz und zur Versorgung von Menschen in einer humanitären Notlage (medizinische Katastrophen, Naturkatastrophen, politische Konflikte etc.).
Humanitäre Hilfe wird sowohl von staatlichen als auch nichtstaatlichen Organisationen durchgeführt und finanziert. Sie kann sowohl zur akuten Linderung von Not nach Krisenfällen dienen als auch längerfristige Ziele verfolgen, beschränkt sich meist aber auf Ersteres.
Das Fundament der humanitären Hilfe sind die vier humanitären Prinzipien: Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. Sie sind auf die Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zurückzuführen, die auf der Basis des humanitären Völkerrechts entwickelt wurden.
Zwar stellt humanitäre Hilfe derzeit im Kontext der europäischen (Außen-)Grenzen eine der wenigen Möglichkeiten dar, politisch gewollte Versorgungslücken für Menschen auf der Flucht annähernd zu schließen und ausbleibende staatliche Verantwortung teilweise aufzufangen. Außerdem zeigen einige Projekte, wie eine solidarische Unterstützung von Menschen abseits von paternalistischen Projektstrukturen möglich ist. Allerdings ist es aus unserer Sicht wichtig zu bedenken, dass zivilgesellschaftlich organisierte humanitäre Hilfe grundsätzlich keine langfristige Lösung für die enormen Schwierigkeiten von People on the Move an europäischen (Außen-)Grenzen sein kann, denn auch wenn humanitäre Hilfe kurzfristig Leid lindern kann, muss sie aus folgenden Gründen kritisch betrachtet werden:
- Humanitäre Hilfe kann nicht neutral sein und verdeckt die hoch-politische Situation in Grenzregionen. Die bestehende Situation an Europas (Außen-)Grenzen ist keine Naturkatastrophe, sondern bewusst von der EU und den Mitgliedstaaten politisch herbeigeführt. Wenn humanitäre Hilfe, die in diesem Feld agiert, als “neutral” beschrieben wird, handelt es sich dabei um eine systematische Entpolitisierung von etwas sehr Politischem. Statt zu sehen, dass die unmenschlichen Lebensbedingungen beispielsweise in Camps für Geflüchtete ein Ergebnis politischer Entscheidungen sind (und dabei u.a. EU-Recht gebrochen wird, indem keine menschenwürdige Versorgung und Unterbringung ermöglicht werden), werden sie als humanitäre Krisen gesehen, auf die mit humanitärer Unterstützung reagiert werden muss. In dem Fokus auf eine 'unpolitische' und 'humanitäre' Unterstützung wird der gewaltvolle politische Kontext, durch den die Notwendigkeit der Unterstützung erst entsteht, ausgeblendet.
- Humanitäre Hilfe ist nicht unparteilich. Da sich Hilfestrukturen in einem höchst politischen Kontext befinden, können sie entweder dazu beitragen, gegen bestehende Strukturen und die staatliche Verantwortung dafür anzugehen, oder sie stabilisieren diese. Da bei humanitärer Hilfe letzteres der Fall ist (siehe zwei Punkte weiter unten), diskriminiert sie letztendlich diejenigen, die sie als Zielgruppe ansehen. Das liegt daran, dass sie ihnen gegenüber steht und mit dafür sorgt, dass Betroffene weiter auf Hilfe angewiesen sind. Außerdem orientiert sich humanitäre Hilfe teilweise an staatlichen Unterscheidungen davon, wer als “gewollt” und wer als “ungewollt” gilt. Dadurch verstetigen diese Projekte die Illegalisierung vieler Schutzsuchende (d.h. dass Schutzsuchende als “illegal” angesehen werden, obwohl kein Mensch illegal sein kann und staatliche Grenzen zu überqueren Menschen nicht rechtlos machen sollte). Die “Helfer*innen” sind also in der Position, zu entscheiden, wer Hilfe “verdient” und wer nicht und ergreifen damit unweigerlich Partei für manche und gegen andere.
- Bestehende Machtstrukturen werden verstärkt. Humanitäre Hilfe steht keinem Machtapparat gegenüber, sondern ist von Machtstrukturen durchzogen. Sie geht davon aus, dass es aktive Helfer*innen und passive Empfänger*innen eben jener Hilfe gibt. Emanzipation und dass Schutzsuchende für sich selbst sprechen, ist dabei nicht vorgesehen. Aufgrund dieser paternalistischen und diskriminierenden Strukturen werden die Betroffenen auf die Opferrolle reduziert, die eigene Handlungsmacht genommen und die politische Subjektivität aberkannt. Dabei wird ausgeblendet, dass es sich bei Menschen auf der Flucht um Personen mit einer individuellen Geschichte und Bedürfnissen handelt, die als aktiv handelnde Personen einen rechtlichen (!) Anspruch auf Unterstützung im Rahmen des Asylsystems haben. Machtbeziehungen und Hierarchien werden also nicht aufgelöst, sondern verstetigt. Daher kann davon gesprochen werden, dass humanitäre Hilfe auch immer Teile von Unterdrückung mit sich bringt.
- Humanitäre Hilfe verstetigt bestehende Strukturen. Humanitäre Hilfe entlastet staatliche Akteur*innen und übernimmt Aufgaben, was zu einer Verstetigung der Situation führt, denn durch das Einspringen in staatlich nicht übernommene Aufgaben wird unsichtbar gemacht, dass der Staat oder die EU ihren Aufgaben nicht nachkommt - die Aufgaben werden dann ja, zumindest teilweise, gemacht. Dadurch kann sich der Staat aus der Verantwortung ziehen, etwas zu ändern. Die Hilfe führt also nicht zu einem progressiven Wandel. Stattdessen können Freiwillige die bestehende Ordnung, gegen die sie vermeintlich angehen, verstetigen, da sie durch ihre Arbeit (unbewusst) dazu beitragen, dass es so weitergeht, wie es ist.
Zusätzlich zu den oben genannten Problematiken ist der Sektor der humanitären Hilfe - wie die Gesellschaft an sich - von Rassismus durchzogen. In einem Bericht von 2021 stellt die Organisation Peace Direct in Zusammenarbeit mit Adeso, der Alliance for Peacebuilding und Women of Color Advancing Peace and Security dies dar. Trotz des Fokus des Berichtes auf Strukturen der Entwicklungszusammenarbeit im Globalen Süden, können die zentralen Ergebnisse auch auf den Kontext der Unterstützungsarbeit an den (Außen-)Grenzen der EU übertragen werden:
- Das Hilfesystem reflektiert noch immer koloniale Praktiken und Einstellungen, die oft nicht anerkannt werden. Koloniale Dynamiken, wie die Ideologie der*s "weißen Retter*in" und rassistische Wahrnehmungen werden noch immer z.B. in Spendenkampagnen und der öffentlichen Kommunikation verstärkt.
- Wohin welches Geld fließt, wird von Akteur*innen im Globalen Norden entschieden und nicht von Menschen, denen es zugute kommen soll. Die globale Aufteilung, wer die Entscheidungsmacht hat, bleibt aus dem Kolonialismus bestehen.
- Struktureller Rassismus ist in der Kultur und Arbeitsweise des Sektors tief verwurzelt. Das bedeutet, dass Organisationen aus dem Globalen Norden vor solchen aus dem Globalen Süden begünstigt werden. Das heißt, sie profitieren von dem strukturellen Rassismus. Fähigkeiten von Mitarbeitenden aus dem Globalen Süden werden dagegen abgewertet und sie werden häufig schlechter bezahlt.
- Der Hilfe-Sektor nutzt bestimmte Begriffe, die diskriminierende und rassistische Vorstellungen von nicht-weißen Bevölkerungsgruppen verstärken (und die bewusst nicht wiederholt werden).
- Die angebliche “Neutralität” ist nicht gegeben, da diese “Neutralität” häufig eine weiße Perspektive darstellt und somit die "weiße Retter*innen"-Mentalität verstärkt
- Programme und Forschung im Hilfe-Sektor orientieren sich oft an westlichen Werten und westlichem Wissen, an die und das sich angepasst werden muss. Dies wertet anderes Wissen und Erfahrungen, insbesondere aus dem Globalen Süden, ab.
- Intersektionale Ansätze werden häufig vernachlässigt. Das heißt, dass die Zielgruppe häufig auf ein bestimmtes Identitätsmerkmal zugeschnitten ist und mehrfach marginalisierte Menschen vernachlässigt werden (z.B. lesbische Frauen, die nur Angebote für Frauen finden, wobei ihre Homosexualität vernachlässigt wird).
Quellen und weiterführende Links:
Peace direct (2021): Time to Decolonise Aid (verschiedene Sprachen) - hierin werden auch Empfehlungen ausgesprochen, was besser gemacht werden kann.
BrückenWind (2021): Warum freiwillige Unterstützungsarbeit an den Außengrenzen notwendig und zwingend politisch ist (DE, EN)
Larissa Fleischmann und Elias Steinhilper (2017): The Myth of Apolitical Volunteering for Refugees: German Welcome Culture and a New Dispositif of Helping (EN)
Rivka Saltiel (2020): Urban Arrival Infrastructures between Political and Humanitarian Support: The ‘Refugee Welcome’ Mo(ve)ment Revisited (EN)
Robin Vandevoordt (2019): Subversive Humanitarianism: Rethinking Refugee Solidarity through Grass-Roots Initiatives (EN)
Robin Vandevoordt und Gert Verschraegen (2019): Subversive Humanitarianism and Its Challenges: Notes on the Political Ambiguities of Civil Refugee Support (EN)
Medico international: (2023): Decolonizing Aid (DE, EN, Indonesi) - Aufzeichnungen einer Veranstaltungsreihe
Sehr zu empfehlen ist auch die Broschüre Willkommen ohne Paternalismus. Hilfe und Solidarität in der Unterstützungsarbeit von glokal e.V.
Solidarische Freiwilligenarbeit
Wir haben oben deutlich gemacht, dass es einige Fallstricke in der Unterstützungsarbeit mit Geflüchteten gibt. Das heißt allerdings nicht, dass man sich zurückziehen und keine Unterstützungsarbeit mehr leisten soll. Im Gegenteil: Wir finden es super, dass du dich dazu entschlossen hast, Freiwilligenarbeit zu leisten und dass du auf dieser Website bist, ist schon mal ein gutes Zeichen, dass du nicht unvorbereitet in die Arbeit gehst oder falls du schon dabei bist, dich weiter informierst.
Uns ist wichtig, Unterstützungsarbeit mit Geflüchteten als politisch anzuerkennen, um die Tätigkeiten in einen größeren Kontext zu setzen, anstatt den bestehenden Kontext der brutalen europäischen Migrations- und Grenzpolitik zu verschleiern. Mit der praktischen Unterstützungsarbeit sollten daher unserer Ansicht nach auch politische Forderungen nach einer grundsätzlichen Änderung der Situation gestellt werden. Hier sind ein paar weitere Denkanstöße, wie du solidarisch Freiwilligenarbeit leisten kannst:
- Die Organisation oder das Projekt sollte sich nicht an staatliche Kategorisierungen von unterschiedlicher Wertigkeit je nach Staatsangehörigkeit oder Vulnerabilität halten, sondern alle Menschen unabhängig von ihrem rechtlichen Status als Mitmenschen begreifen, mit denen gemeinsam gearbeitet wird. Das schließt nicht aus, dass es Angebote für bestimmte Gruppen geben kann.
- Hab im Kopf, dass praktische Unterstützungsarbeit (wie beispielsweise Essensausgabe für wohnungslose Menschen) häufig notwendige Symptombekämpfung ist, aber dass die Ursachen für die “Symptome” (wie Wohnungslosigkeit und fehlende Nahrungsmittel) politisch sind (wie mangelnde staatliche Bereitstellung von Wohnraum und fehlende staatliche Unterstützungsstrukturen im Falle von Wohnungslosigkeit).
- Denke daran, dass alle Menschen (mit denen du arbeitest) unabhängige, eigenständige, politische Menschen sind, denen die eigene Stimme nicht genommen werden darf. Stattdessen muss gerade dafür Platz und Raum geschaffen werden, ohne sie zu exponieren und zu gefährden.
- Du solltest deine Arbeit nicht so verstehen, dass du dich um Menschen kümmerst, oder ihnen hilfst, sondern in Solidarität gemeinsam mit ihnen für die Veränderung der aktuellen untragbaren Situation einstehst.
- Wie oben erwähnt, gibt es immer mehr Repressionen und Kriminalisierung gegenüber der Unterstützungsarbeit für Migrant*innen und Menschen auf der Flucht. Sich davon nicht einschüchtern zu lassen und weiter zu machen ist enorm wichtig, weil sonst menschenfeindliche und nationalistische Politiken akzeptiert werden und “gewinnen”. Das heißt, dass Unterstützungsarbeit nicht nur durch ihre Form, also die konkreten Handlungen, sondern auch durch ihre implizite Opposition gegen das herrschende gesellschaftspolitische Klima eine wichtige Symbolkraft trägt, indem man sich nicht einschüchtern lässt und weiterhin solidarisch bleibt. Dennoch musst du dir natürlich über mögliche Sanktionen bewusst sein und überlegte Entscheidungen treffen.
Was sind deine Stärken? Hast du besondere Fähigkeiten, die in Projekten der Freiwilligenarbeit hilfreich sein könnten?
Bedeutung für dich und das Projekt:- Du ersparst dir etwaige Über- oder Unterforderung in der Projektarbeit, was wiederum deine langfristigen Kapazitäten stark beeinflussen kann.
- Du gibst deinem Team die Möglichkeit, dich möglichst passend einzusetzen und von deinem Erfahrungswissen und deinen persönlichen Fähigkeiten zu profitieren.
Überlege, welche deiner Fähigkeiten oder Kenntnisse du gut in die Unterstützungsarbeit einbringen könntest und welche der Projekte oder Tätigkeiten dazu passen würden. Wenn dir nichts einfällt, ist das auch kein Problem. Es gibt auch Aufgaben und Organisationen, bei denen keine Vorkenntnisse notwendig sind.
Wie viel Zeit kannst du für deine Freiwilligenarbeit investieren?
Bedeutung für dich und das Projekt:
- Da manche Projekte eine Mindestteilnahmedauer vorschreiben oder empfehlen, kannst du hierdurch bereits solche Projekte herausfiltern, die für dich zeitlich nicht in Frage kommen.
- Je nach Projekt ist die Dauer deiner Freiwilligenarbeit sehr relevant für bestimmte Projekte und Vorhaben. Nimm dir lieber nicht allzu viel vor, sondern überleg dir mit deinem Team, was in der Zeit deiner Mitarbeit sinnvolle Aufgaben sein könnten. Da es meist um die direkte Arbeit mit Menschen geht, hab auch vor Augen, dass die Dauer der Mitarbeit sich auf Beziehungen auswirkt, woraus Verantwortungen entstehen.
Informiere dich in dieser Hinsicht genau über die empfohlene Dauer für ein Projekt und die entsprechende Begründung. Jede*r Freiwillige bedeutet für die Koordination Organisationsaufwand und Einarbeitungszeit, sodass du mit der Zeit natürlich mehr machen kannst. Die Bestimmung der Dauer der Mitarbeit liegt natürlich im Ermessen der Projektleitung und kann je nach Projektphase und Saison abweichen. Allerdings gilt grundsätzlich: Je mehr Zeit du für deinen Freiwilligenarbeit einplanen kannst, desto mehr Hilfe und Unterstützung bedeutet deine Mitarbeit für das Projekt. Bei sehr kurzen Aufenthalten an anderen Orten stehen die auf deiner Seite entstehenden Reisekosten und der auf der Seite des Projekts stehende Organisationsaufwand in keinem Verhältnis zum effektiven Mehrwert. Teilweise ist es daher nicht sinnvoll oder gar nicht möglich, für wenige Wochen oder Monate in einem Projekt zu arbeiten. In diesem Fall könntest du dir stattdessen überlegen, potentiell investiertes Geld an eine Organisation zu spenden oder den Aufenthalt für einen anderen Zeitpunkt zu planen.
Wie schätzt du deine eigene mentale und körperliche Belastbarkeit ein?
Bedeutung für dich und das Projekt:- Durch eine ehrliche Auseinandersetzung und Reflexion mit deiner Belastbarkeit vermeidest du, dass dich die Arbeit im Projekt auf Dauer überfordert und negativ auf deine Gesundheit auswirkt. Dabei gilt: Deine persönlichen Grenzen sind wegweisend und legitim! Kommuniziere sie und berücksichtige sie jederzeit.
- Hauptsächlich geht es natürlich um deine Gesundheit. Weiterhin ist die Auseinandersetzung mit deinen persönlichen Grenzen aber auch wichtig, weil du damit dem Projekt und deinem Team einen Gefallen tust.Dein psychisches und physisches Wohlbefinden liegt im Interesse aller Beteiligten, denn du kannst andere Menschen nicht gut oder langfristig unterstützen, wenn es sich negativ auf dich auswirkt. Außerdem kannst du auch andere ermutigen, die eigenen Grenzen deutlich zu kommunizieren, um Überlastung, Erschöpfung oder Stress zu vermeiden.
Informiere dich in dieser Hinsicht vorab z.B. durch Erfahrungsberichte von anderen Freiwilligen mit der Situation und möglichen Stressfaktoren der Arbeit und versuche anschließend, zu evaluieren, wie du hierauf außerhalb deines gewohnten Umfelds reagieren würdest (mehr dazu auch in Themenblock 2 und 7). Insbesondere die Unterstützungsarbeit mit besonders schutzbedürftigen Menschen in Krisensituationen kann für Freiwillige sehr belastend sein. Zudem erfordert die Projektarbeit meist ein hohes Maß an Eigenständigkeit und einen hohen zeitlichen Arbeitsaufwand. Um die Arbeit dennoch gut zu meistern, hilft es, sich darüber vorab bereits Gedanken zu machen. Diesbezüglich kannst du auch mit Freund*innen und Familie sprechen und dir deren Einschätzungen einholen. Im Rahmen dieser Selbstreflexion können Faktoren wie dein Alter, mentale Vorbelastungen oder chronische Erkrankungen eine Rolle spielen, müssen es aber nicht.
Versuche bereits im Vorhinein, aber auch nach Beginn deiner Freiwilligenarbeit, deine Energiereserven einzuschätzen. Die Erfahrungen, die du bei der Arbeit machst und die Arbeitsumstände können auf Dauer durchaus mental belastend sein. Gleichzeitig wird in der schnelllebigen Freiwilligenarbeit häufig eine stetig hohe Motivation und Energie seitens der Freiwilligen erwartet. Anderswo gültige Arbeitsbedingungen werden hier teilweise nicht immer eingehalten. Um dich selbst zu schützen, kannst du bereits vorab mit der Projektleitung absprechen, in welchem Umfang deine Mitarbeit stattfinden kann, wann Pausen, wann Urlaub erforderlich ist, wenn du dies für sinnvoll hälst. Bei Langzeitaufenthalten empfiehlt es sich - in deinem Sinne, aber auch im Sinne des Projekts - nach etwa drei Monaten die Möglichkeit der Verlängerung ggf. gemeinsam mit der Projektleitung zu evaluieren.
Welche Erwartungen hast du an das Projekt und den Einfluss deiner Arbeit? Was genau möchtest du unter dem Anspruch, andere Menschen zu unterstützen, erreichen? Was ist deine Motivation, das zu tun?
Bedeutung für dich und das Projekt:- Die persönlichen Wünsche und Erwartungen zu reflektieren, kann dich über die Projektarbeit hinweg motivieren und dich bei verschiedenen Fragen und Herausforderungen daran erinnern, warum du dich solidarisch mit deinen Mitmeschen zeigen willst.
- Dein Team, das Projekt und die Menschen, mit denen du zusammen arbeitest, profitieren von einem offenen und transparenten Umgang. Sei dir allerdings bewusst, dass deine eigenen Erwartungen und Ziele nicht zwingend umgesetzt werden - die Einzelperson kann in einem System von Ungerechtigkeiten meist nur relativ wenig erreichen.
- Hinterfrage deine eigene Motivation, denn diese ist nicht ausschließlich selbstlos. Schutzsuchende Menschen haben einen Anspruch, zu erfahren, warum sich Menschen für sie und mit ihnen einsetzen, ebenso wie sie entscheiden können, welche Unterstützung sie annehmen wollen und welche nicht.
Auch wenn Freiwilligenarbeit in erster Linie dem Projekt und dessen Empfänger*innen dienen soll, ist es sinnvoll anzuerkennen, dass du als Freiwillige*r persönliche Ansprüche an die Arbeit im Projekt hast und bestimmte Vorstellungen und Ziele damit verbindest. Diese anzuerkennen und sie sich im Vorhinein, sowie während deiner Freiwilligenarbeit vor Augen zu führen, kann sowohl dir persönlich als auch dem Projekt oder deinem Team an sich dienen, auch wenn diese nicht immer erfüllt werden können. Rede mit deinem Team darüber - meistens geht es vielen ähnlich.
Fragen? Kritik? Anmerkungen? Ergänzungen?
Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen und hilfreiche Hinweise von Euch! Schreibt uns einfach eine Email: kontakt@brueckenwind.orgDu möchtest unsere Inhalte teilen?

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz